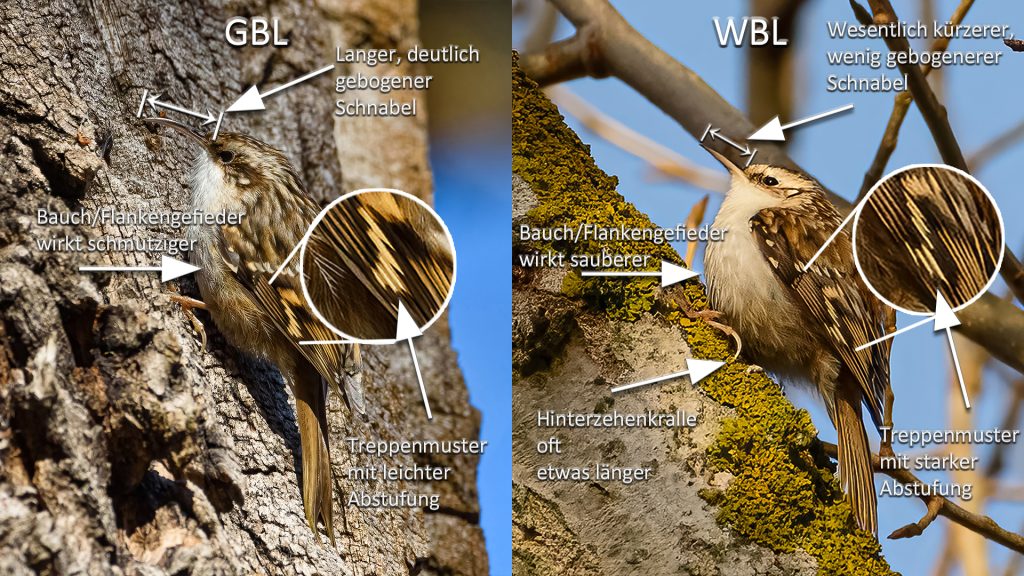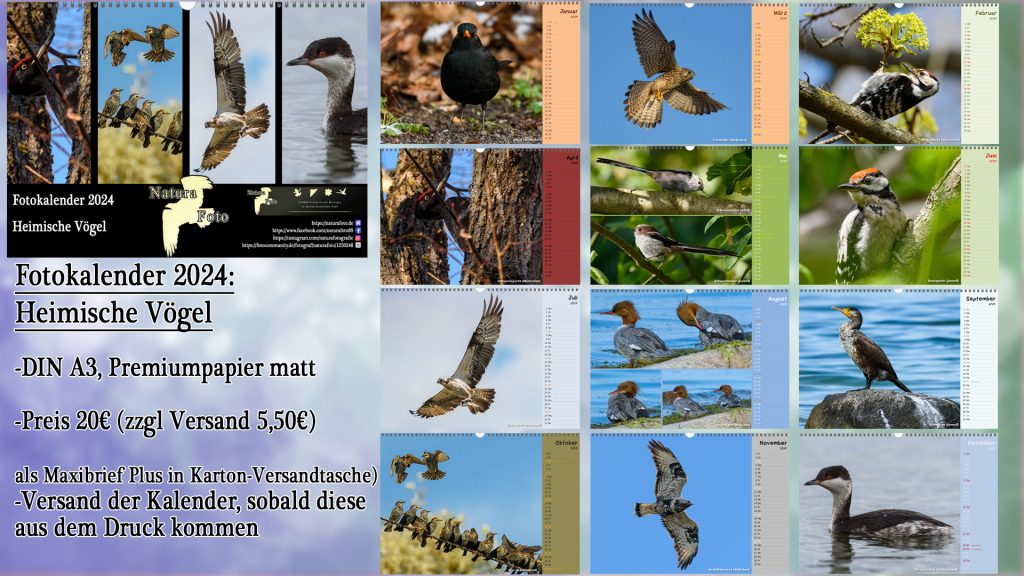Zumindest was die Morphe, also das Erscheinungsbild anbelangt, kann man sagen, dass dieser Mäusebussard ein ganz schön heller ist Diese hellen Morphen sorgen regelmäßig für Verwirrungen bei Bestimmungen und so werden helle Mäusebussarde oft als Raufußbussarde fehlbestimmt, obwohl Raufußbussarde (u.a.) oft sogar viel dunkler sind als die hellen Morphen des Mäusebussards. Auch wird die Häufigkeit von Raufußbussarden im Winter oft massiv überschätzt; wenn man sich wirklich jeden Bussard in vielen verschiedenen Gebieten im Winterhalbjahr anschaut, liegt die Wahrscheinlichkeit darunter einen Raufußbussard zu entdecken irgendwo in der Größenordnung im Bereich zwischen 1:x00 – 1:x.000 (abhängig von Geographie, Einflug und den Bedingungen zur zweifelsfreien Bestimmung).
Alles zur Bestimmung zum seltenen Raufußbussard habe ich HIER niedergeschrieben.
Damit aber erst einmal zurück zum Mäusebussard, liebevoll auch “Mausi” oder früher oft “Mauser” genannt. Anfang März, als ich dieses Individuum fotografiert habe, findet auch die Balz statt. Reviere werden dabei, oft auch paarweise, durch ausdauerndes Rufen beim Kreisen verteidigt. Das Männchen zeigt zur Balzzeit die als Girlandenflug bezeichneten Balzflüge, bei der er sich aus der Höhe herabstürzen lässt, wieder hinaufsteigt und die Stürzflüge dabei oft immer steiler, tiefer und rasanter werden, um dem Weibchen seine Fitness zu präsentieren.